Ich habe einen netten Artikel gefunden: Whale Fall. Es geht darum, was mit großen Freie-Software-Projekten passiert, wenn sie sterben. Der Autor vergleicht das mit dem Phänomen des Walsturzes, also wenn ein Wal auf hoher See stirbt, in die Tiefsee absinkt und der Kadaver dort ein eigenes Ökosystem bildet. Analog dazu wird aufgezeigt, wie andere Projekte von so etwas beeinflusst werden.
— Hannelore (Questionable Content)The AIs tried talking to dolphins, but they stopped because dolphins are apparently really creepy to talk to.
Rollenspielszenen: Transzendente Graffiti
Rollenspielszene. Wir sind Punks in einem Eldritch-Zug. Wir leben dort. Es passieren immer wieder realitätsverzerrende Dinge. Deswegen ist Jack auch nicht zu sehr überrascht, als er plötzlich weit weg von seinen Freunden im Speisewagen sitzt, ohne die ohnmächtige Person, die er retten wollte, und ohne Fenster und ohne Türen.
Jack ist Künstler und kann mit seinen Graffiti besondere Effekte erzielen. Zum Beispiel kann er etwas, das er auf eine Wand sprüht, auch auf einer entfernten Wand erscheinen lassen, die er vorher schon gesehen hat.
Es funktioniert: Jacks Freunde sehen einen Schriftzug auf der Wand:
Mir geht es gut. Bin im Speisewagen.
Ein Problem nur: Jacks Freunde wissen genau, wo Jack ist. Jack ist vor ihren Auge ohnmächtig geworden, so wie die Leute, die sie retten wollten. Jack ist nicht im Speisewagen. Jack hat in einem Traum etwas an die Wand gesprüht, was dann in der wirklichen Welt erschienen ist.
Rollenspielszenen: Verfluchte Zunge
Rollenspielszene. Das Amulett, das wir suchen, ist in einem Hobgoblinfort, das die Hobgoblins in uralten elfischen Ruinen gebaut haben. Soris der Druide hat in der Gestalt eines Stinktiers schon ein bisschen kundschaften können, aber wir brauchen andere Mittel, um an das Amulett zu kommen.
Also verkleidet sich unser Magier Prattle sich mit einem Zauber als hochranginger Hobgoblin (den wir beim letzten Mal bekämpft haben). Dumm nur: Prattle kann kein Wort der Goblinsprache. Am Tor des Forts tut er mürrisch, grummelt vor sich hin und wird von den Wachen hereingelassen.
Prattle zaubert sich einen Morastgestank an, um die Ursache seiner Unmut zu erklären und wird von einem Hobgoblin in Richtung Keller gewiesen. Während er unten durch die Gänge streift, kommt aus dem Raum des Hobgoblinbosses ein Magier heraus, der die Person, die Prattle verkörpert, wohl kennt und ihn anspricht.
Was tun? Mürrisch zu grummeln funktioniert nicht bei Gleichrangigen. Prattle hat die rettende Idee: Er fängt an, mit dem Magier auf der Feensprache Sylvan zu sprechen und behauptet, verflucht worden zu sein. Der Magier kauft ihm das ab und bietet auch noch an, für ihn beim Boss zu übersetzen.
Sonnenuntergang und Schleimpilz
Ein Arbeitskollege hat auf einem seiner Blogs mit WebGL eine Sonnenauf-/untergangssimulation eingebaut. Wenn man dort auf einen Link klickt, bewegt sich die Sonne und ändert auch die Farbe des Himmels. Das ganze sieht ziemlich gut aus. Ich habe auch ein kleines Video davon aufgenommen und auf Peertube hochgeladen. Mal sehen, welcher von den beiden Links länger überlebt. Schaut euch wenn ihr könnt lieber das Original an.
Das Schöne: Das gesamte Script dafür ist gerade mal um die 11 kiB groß, also recht klein. Und es stört die Funktionalität der Seite auch nicht, wenn man Javascript blockert. Dann kann man die Texte immer noch genau so gut lesen, verpasst halt nur diese Spielerei mit der Sonne.
Und da der Kollege noch keinen Post über die Implementierung der Sonne gemacht hat, verlinke ich stattdessen auf einen Post auf seinem anderen Blog (dieses Blog ist techniklastiger, wobei das andere eher erzählerisch-philosophisch ausgerichtet ist), wo er Schleimpilze simuliert. Auch mit WebGL, auch schön anzusehen. Und mit einer schönen Erklärung, wie es funktioniert.
CSS, grau, grey und gray
Aus der Serie „Dinge, die ich nie über CSS wissen wollte aber herauszufinden gezwungen war“: Neulich habe wollte ich mal verschiedene mögliche Varianten einer SVG-Datei mit transparentem Hintergrund vor verschiedenen Hintergründen darstellen. Zuerst nur schwarzer und weißer Hintergrund, aber dann habe ich mir gedacht, ich könnte ja eigentlich auch ein paar Grauwerte ausprobieren.
Ich fand es schöner, das mit den CSS-Farbnamen zu machen als mir manuell die Grauwerte herauszusuchen. Dabei habe ich zwei Dinge gelernt.
Erstens: Es gibt in CSS sowohl grey als auch gray. Eine kurze Recherche ergab: Beide sind gültig, beide referenzieren denselben RGB-Farbwert #808080 und wurden vermutlich eingeführt, damit sich Briten und Amis nicht in die Haare geraten, wie es zum Beispiel auf Wikipedia passiert ist. Es wird aber geraten, sich in einer CSS-Datei auf eine Variante zu einigen. Diese doppelte Benennung gibt es auch für andere Grautöne, wie lightgrey und darkgrey Aufgefallen ist mir das, weil ich in einer Liste die RGB-Farbwerte nachgeschaut und je nach Grauton eine unterschiedliche Schreibweise gefunden habe.
À propos lightgrey und darkgrey: Die zweite Sache, die ich gelernt habe ist, dass darkgrey heller ist als grey. Ich hatte mich schon gefragt, ob ich irgendwo falsche Klassen vergeben oder im CSS Mist gebaut habe. Aber nein. Ich wollte drei Blöcke haben, mit immer dunkler werdenden Grautönen und hatte stattdessen #D3D3D3 (lightgrey), #808080 (grey) und #A9A9A9 (darkgrey). Ich weiß nicht, wer sich, das ausgedacht hat, aber es ist sehr kontraintuitiv. Ich habe dann als dunkelsten Grauwert doch manuell einen Wert eingegeben, #444444.
So, und jetzt werde ich mich wieder den schöneren Seiten widmen. Zum Beispiel, dass man heutzutage viele frühere CSS-Hacks durch sauberere, moderne Lösungen ersetzen kann.
PeerPressure: Videos
In meinem kürzlichen Post über mein kleines PeerPressure-Kunstprojekt habe ich ja versprochen, dass noch ein Video kommt. Das kommt jetzt auch. Vorher aber ein paar kleine Anmerkungen dazu.
…
Meine Güte war es schwierig, die Videodatei klein zu halten. Aber fange ich mal vorne an.
Änderungen am Ablauf
Beim letzten Mal hatte ich ja etwa 100.000 Rechenschritte gemacht. Ich habe das Programm danach erweitert und eine Obergrenze bei einer Million gesetzt, wobei das Programm vorzeitig abbrechen sollte, wenn nur noch eine Farbe auf dem Spielfeld ist (weil sich dann nichts mehr verändert). Außerdem habe ich nur noch von jedem 10. Schritt ein Bild abgespeichert.
Wann (ob?) dieser vorzeitige Abbruchpunkt erreicht ist, ist unterschiedlich. Ich habe mich am Ende für einen Durchlauf entschieden, wo nach weniger als 428.240 Schritten abgebrochen wurde. Ich hatte also 42825 Bilder. Und damit kommen wir zum Encoding.
Video-Encoding-Herausforderungen
Letztes Mal hatte ich eine WEBM-Datei mit VP9 als Encoding verwendet. Das hatte zwei Probleme: Erstens hat es mit dem Ecndoing ewig gedauert, zweitens gab es hinterher bei der Darstellung ganz scheußliche Kompressionsartefakte.
Also habe ich es mit MP4 als container unf H.264 als Encoding versucht. Das ging deutlich schneller, hatte kaum Kompressionsartefakte, aber die Datei war am Ende für etwa eine Stunde Laufzeit 1.1 GiB groß (1.5 GiB mit H.264). Habe ich erwähnt, dass die Auflösung 240p ist, als nur 426×240 Pixel? Zum Vergleich: Die rohen Bilddateien (PNG) waren nur weniger als 400 MiB groß. Wo soll ich denn bitte so ein Monster hochladen?
Ich vermute mal, dass das an den scharfen Kanten und den zufälligen Änderungen zwischen den Kanten lag. Also habe ich mal ausprobiert, die Bilder vorher zu glätten. Ein 3×3 Gaußfilter, so dass alles viel unschärfer aussieht. Man kann die einzelnen Zellen kaum noch erkennen, aber vielleicht sieht es ja trotzdem gut aus. Und die Kompressionsartefakte sollten auch nicht mehr so ins Gewicht fallen.

Das Ergebnis war super: Die Videodatei (MP4, H.264) war nur noch 223 MiB groß. Immer noch ziemlich groß, aber schon deutlich besser. Mit VP9 wurde das Video in diesem Fall gröer als H.264. Nur: Das ist natürlich immer noch zu groß für Pixelfed, Youtube will ich eigentlich vermeiden, und für PeerTube brauche ich erst einmal noch ein bisschen Zeit, weil die Instanz meiner Wahl meinen Accountantrag erst prüfen will.
Also kommt jetzt erst einmal nur ein kurzes, dafür aber nicht geglättetes Video auf Pixelfed.
Update, 2026-02-16: Hier kommt das geglättete Video auf Peertube. Unglücklicherweise sind dort beim Umcodieren doch wieder einige extreme Kompressionsartefakte eingefügt worden. Ich habe auch noch ein bisschen herumprobiert: H.265 wäre hier tatsächlich kleiner, allerdings sieht man deutlich ein paar Kompressionsartefakte (wenn auch nicht so schlimm wie auf der Peertube-Version. Und ein APNG, also eine animierte PNG-Datei (ungeglättet) ist noch kleiner und sogar verlustfrei (ich habe es aber nur mit 1000 Frames getestet). Aber eine APNG ist undhandlich, weil sie von Browsern wie eine Bilddatei und nicht wie ein Video behandelt wird. Also bleibt mir nur die Version mit Kompressionsartefakten. Mein nächstes Projekt wird wieder leichter komprimierbar sein, versprochen!
Statistik
Hatte ich erwähnt, dass ich auch mit jedem Bild abgespeichert habe, wie viele schwarze Pixel es im Bild gibt? Daraus habe ich dann für den Durchlauf, aus dem das Video oben stammt, eine Grafik gemacht:
Bonus: Wie glätte ich tausende Bilder?
Eigentlich geht das Glätten eines Bildes mit imagemagick ganz einfach (Warnung: mogrify überschreibt das Eingabebild. Verwendet convert, wenn ihr eine veränderte Kopie erstellen wollt):
mogrify -gaussian-blur 3x3 image.png
Oder mehr als 3x3, wenn man es stärker glätten möchte. Mehrere Dateien sind dann eigentlich ganz einfach:
mogrify -gaussian-blur 3x3 *.png
Hier gibt es aber ein Problem: in Bash wird der Wildcard-Operator * von der Shell ausgewertet und dann eine Liste von Dateinamenn and das Programm gegeben. Irgendwo ist aber mit der Anzahl der Dateinamen Schluss. Wenn man 100.000 Bilder hat, passiert, kriegt man den Fehler Argument list too long.
Manche Programme erlauben es, als Input ein Verzeichnis anzugeben. mogrify nicht, zumindest habe ich keine Möglichkeit dazu gefunden. Also habe ich einen Workaround genutzt:
find . -name '*.png' -execdir mogrify -gaussian-blur 3x3 {} \;
Das sucht alle Dateien, die mit .png enden im aktuellen Verzeichnis und ruft drauf den mogrify-Befehl auf. Nachteil: Der Befehl wird sehr oft aufgerufen, das erzeugt einen Overhead. Stattdessen kann man auch folgendes machen:
find . -name '*.png' -execdir mogrify -gaussian-blur 3x3 {} \+
Das ruft den Unterbefehl mit langen, aber nicht zu langen Listen von Treffern auf, so dass ein Mittelweg gefunden ist.
Kleines Kunstprojekt: PeerPressure
Ich habe neulich einen Blogpost zu Creative Coding gelesen. Der Post ist eine Einführung für Anfänger, wie man mit ziemlich wenig Code schon interessante Bilder erzeugen kann. Das hat mich motiviert, auch mal wieder aktiv zu werden und ein simples Programm zu schreiben, das mir schon länger im Kopf herumschwebt.
Im Prinzip ist das Programm ein einfacher zellulärer Automat, aber randomisiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelle im nächsten Schritt einen bestimmten Zustand hat, ist proportional zur Anzahl der benachbarten Zellen (inklusive der Zelle selbst), die in diesem Zustand sind. Beispiel: Eine schwarze Zelle mit vier schwarzen und vier weißen Nachbarn hat eine Wahrscheinlichkeit von 5/9, im nächsten Schritt schwarz zu sein und 4/9, weiß zu sein. Eine schwarze Zelle, die komplett von schwarzen Zellen umgeben ist, bleibt demnach auf jeden Fall schwarz.
Wenn der Anfangszustand so ist:

…dann kann es nach 100 Schritten zum Beispiel so aussehen:
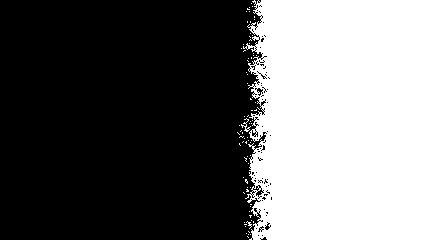
…und nach 99999 Schritten so:
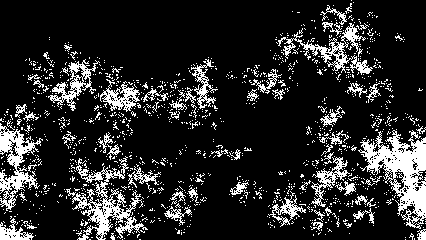
Es hat mich etwa eine halbe Stunde gekostet, das grundlegende Programm dafür zu schreiben. Der Code ist auf Codeberg. Ich habe ein bisschen damit herumgespielt. Es hat etwa 80 Sekunden gedauert, 100.000 Schritte zu durchlaufen und für jeden Schritt ein PNG abzuspeichern. Das lässt sich sicher noch verbessern, aber ich sehe gerade nicht viel Sinn darin, denn der eigentliche Flaschenhals ist das Rendern eines Videos daraus. Denn eigentlich sieht das am Schönsten aus, wenn man sieht, wie es sich entwickelt. ffmpeg hat über 2,5 Stunden gebraucht, um aus den 100000 Bildern ein Video zu machen, und das ist nur ein 240p-Video (426×240).
Zudem gibt es in dem Video noch einige Kompressionsartefakte, die es unschön machen, es anzuschauen. Auch die Dateigröße ist ziemlich groß. Ich lade garantiert noch einmal ein Video dazu hoch, aber vorher muss ich ein bisschen mit Codecs und anderen Einstellungen herumprobieren. Vielleicht mache ich auch eine Version, in der ich vorher jedes Bild mit einem Gaußfilter glätte. Oder einen Zeitraffer, wo nur jeder 10. Zustand oder so ins Video kommt.
Fun Fact am Ende: Die 100.000 Bilder waren etwa 1,3 GiB groß. Mit optipng optimiert dann nur noch etwa 750 MiB. Mit zopflipng wäre das vermutlich noch ein bisschen weniger geworden, aber optipng, was schon recht schnell ist, hat mir schon zu lange gebraucht, mit Zopfli hätte das Stunden gedauert.
Rollenpielszenen: Treffen auf dem Dach
Rollenspielszene: Die Band Spice of Life ist in einer ikarischen Militärbasis, wo sie ihren ersten Auftritt haben soll. Dort sind auch ein paar unfreiwillige junge Soldat_innen (Wehrpflicht), die gegen unseren Auftritt protestieren.
Da wir Spione des Nachbarlandes, der Wasted Lands sind, wollen wir unsere geheimen Nachrichten an eine Kontaktperson übermitteln. Die geheime Botschaft haben wir in einem Musiktape verschlüsselt und erst einmal auf unserem Zimmer gelassen.
Nach dem Essen müssen wir auf unserem Zimmer feststellen: Das Tape ist weg! Nur eine Botschaft ist da: „Wenn ihr das Tape zurück haben wollt, trefft uns auf dem Dach“.
Cinnamon (kurz „Cin“) ist begeistert! Ein Stelldichein auf dem Dach! Sehr enttäuscht muss Cin dann aber festtellen, dass Penelope, eine der demonstrierenden Soldat_innen, keine Lust auf körperliche Freuden hat, sondern uns wirklich nur davon abhalten will, unser Konzert zu halten, im Austausch gegen unser Tape (von dessen wahrem Inhalt sie nichts weiß).
Maschinenlesbar
„Wir müssen digitalisieren“, das höre ich in der einen oder anderen Variante oft. Nicht selten bedeutet das aber, dass analoge Arbeitsabläufe 1:1 in Computer übertragen werden, obwohl die Arbeitsabläufe für den analogen Weg optimiert waren und man sie mit dem Computer vielleicht ganz anders gestalten sollte, um effizient und effektiv zu sein.
Ähnlich ist das auch bei der Datenhaltung. Öffentliche Daten sollten auch digital bereitgestellt werden, doch nicht selten bedeutet das, dass irgendwo Bilddateien, PDFs oder PDFs, die nur aus Bilddateien bestehen, hochgeladen werden. Was wir aber wirklich brauchen, sind maschinenlesbare Daten. Dummerweise gehen die Definitionen von „maschinenlesbar“ oft auseinander.
Auf stefan.bloggt.es hat der Blogautor einen Post veröffentlicht, in dem er den Begriff in verschiedenen Sichtweisen definiert, erklärt, was er findet, was wir brauchen, um öffentliche Daten sinnvoll zu nutzen und sich die Gesetzeslage dazu angeschaut. Lest es euch mal durch!
Rollenspielszenen: Kletternde Goblins
Rollenspielszene. Wir sind weiterhin in Goblingebieten und suchen jetzt nach einem Amulett, das uns vielleicht vor der Wilden Jagd verbergen kann. Auf dem Weg zu alten elfischen Ruinen wird eine Gruppe von Hobgoblins auf uns aufmerksam. Sie schicken mehrmals Goblintrupps hinter uns her, die wir aber immer verscheuchen können. Die Goblins sind auch nicht wirklich erpicht darauf, gegen uns zu kämpfen.
Irgendwann wird es den Hobgoblins zu bunt und sie schicken eine Gruppe Worgreiter los, die eine Gruppe von Goblins vor sich herhetzt. Dieses Mal sind auch die Hobgoblins selber dabei, inklusive eines Zauberwirkers.
Soris und Mavas sehen sich bald von Worgen umzingelt. Prattle ist auf einen Baum geklettert und wirkt von dort oben taktisch günstige Zauber. Die meisten. Eigentlich wäre er ein primäres Ziel, aber… die meisten Gegner sind wie gesagt mit Soris und Mavas beschäftigt. Nur die Goblins ohne Worg sehen die Gelegenheit: Sie klettern den Baum hoch, auf dem Prattle sitzt!
Oder eher: Sie geben vor, vergeblich zu versuchen, den Baum hochzuklettern, um ein Alibi dafür zu haben, nicht kämpfen zu müssen. Immer wieder fallen sie aus geringer Höhe herunter, fluchen und jammern, wie schade es doch ist, dass sie den Baum nicht hochkommen. Sonst würden sie sicher ehrenhaft gegen diesen Magier kämpfen, ganz klar!